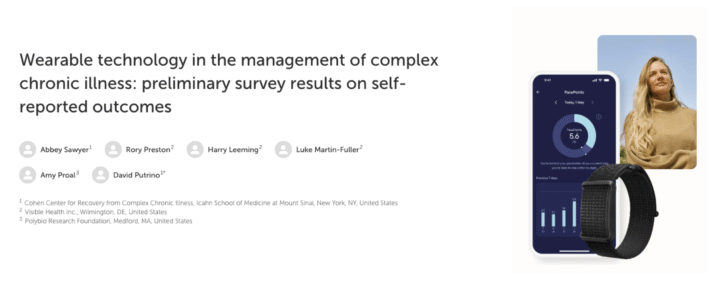Insights from healthcare professionals on enhancing fatigue management inchronic conditions: a qualitative study

Um was geht es?
Das Leben mit chronischen Erkrankungen geht oft mit einem hartnäckigen und tiefgreifenden Begleiter einher: Fatigue. Dabei handelt es sich nicht um gewöhnliche Müdigkeit, sondern um eine tiefe körperliche Erschöpfung, die sich durch Ruhe nicht bessert und sehr lange anhalten kann. Sehr viele Menschen mit chronischen Erkrankungen sind davon betroffen. Fatigue ist komplex und oftmals dauerhaft, sodass Betroffene lernen müssen, mit ihr zu leben. Trotz ihrer weitreichenden Auswirkungen wird Fatigue im klinischen Alltag häufig übersehen oder unzureichend behandelt.
Die aktuelle qualitative Studie beleuchtet „Activity Pacing“ als vielversprechende Strategie, um Fatigue zu managen und die Lebensqualität zu verbessern. Ziel war es, die Perspektiven von Gesundheitsfachkräften (HCPs) zu erfassen und zu verstehen, wie sie Aktivitätsdosierung einschätzen und anwenden.
Welche Erkentnisse wurden gewonnen?
Activity Pacing ist nicht einfach
Die befragten Gesundheitsfachkräfte machten deutlich, dass „Activity Pacing“ kein einfaches Konzept ist. Hinter dem Begriff steckt weit mehr als nur „langsamer machen“. Es geht darum, Menschen mit chronischer Fatigue zu helfen, ihre begrenzte Energie so einzuteilen, dass sie möglichst viel Lebensqualität zurückgewinnen – ohne dabei in Erschöpfungsschübe zu geraten. Das Ziel ist nicht Heilung, sondern ein stabilerer Alltag.
Warum Pacing schwierig ist
Viele Patient*innen kämpfen damit, Pacing konsequent umzusetzen. Ein Grund dafür sind psychologische Barrieren: Manche haben Angst, sich zu überlasten und in einen „Boom-and-Bust“-Zyklus zu geraten – also Phasen der Überanstrengung, gefolgt von vollständiger Erschöpfung. Andere verspüren einen starken Leistungsdrang, der sie antreibt, ihr früheres Aktivitätsniveau zu halten – oft mit dem Ergebnis, dass sich die Fatigue noch verschlimmert. Hinzu kommt, dass manche ihre Erschöpfung vor anderen verbergen, um nicht als schwach zu gelten, und dann später den Preis dafür zahlen. Besonders hinderlich ist auch die fehlende Akzeptanz der Fatigue, die in Studien mit höheren Erschöpfungswerten in Verbindung gebracht wird.
Neben den inneren Hürden gibt es ganz praktische Probleme: Oft fehlt sowohl Patient*innen als auch Fachkräften ein umfassendes Verständnis davon, was Fatigue wirklich bedeutet. Unvorhersehbare Lebensereignisse – etwa ein Trauerfall oder eine Umzugssituation – können Symptome abrupt verschlechtern. Arbeitsanforderungen, wie straffe Deadlines oder körperlich belastende Tätigkeiten, machen es schwer, ein gleichmässiges Aktivitätsniveau zu halten. Und selbst die Wohnumgebung kann zum Problem werden: Treppen, weite Wege innerhalb der Wohnung oder schwer erreichbare Alltagsgegenstände können für Menschen mit stark eingeschränkter Energie eine erhebliche Belastung darstellen.
Massgeschneiderte und ganzheitliche Strategien
Die Fachkräfte waren sich einig: Pacing funktioniert am besten, wenn es individuell zugeschnitten ist. Das bedeutet, dass jede Person ihre eigenen Energiegrenzen, Lebensumstände und Ziele berücksichtigt. Dabei ist es entscheidend, Patient*innen zu ermutigen, ihren eigenen Weg zu finden und selbstbestimmt Entscheidungen zu treffen.
Gleichzeitig sollte das Fatigue-Management immer ganzheitlich sein. Hier setzen viele auf das sogenannte biopsychosoziale Modell. Es umfasst mehrere Dimensionen:
-
Körperliche Aktivität: Bewegung bleibt wichtig, doch sollte sie so gestaltet werden, dass sie den individuellen Möglichkeiten entspricht. Manche Fachkräfte vermeiden bewusst den Begriff „Sport“, da er Leistungsdruck erzeugen kann.
-
Mentale Aktivität: Auch geistige Anstrengung verbraucht Energie. Wer z.B. lange am Computer arbeitet, sollte dies ebenso in die Energiebilanz einrechnen wie körperliche Aufgaben.
-
Emotionales Wohlbefinden: Stress, Angst oder depressive Verstimmungen können Fatigue verstärken – in manchen Fällen ist es sogar notwendig, zunächst an der psychischen Stabilität zu arbeiten, bevor körperliche Aktivität gesteigert wird.
-
Soziale Faktoren: Unterstützung durch Familie und Freunde kann helfen, Überlastung zu vermeiden. Umgekehrt können Konflikte oder soziale Verpflichtungen Energie rauben.
-
Umweltfaktoren: Von der Treppenanzahl in der Wohnung bis zur Sitzhöhe des Sofas – das Wohnumfeld beeinflusst, wie energieaufwendig der Alltag ist.
Zentrale Prinzipien für erfolgreiches Pacing
Die Expert*innen nannten mehrere Grundregeln, die sich in der Praxis bewährt haben:
-
Boom-and-Bust vermeiden: Ziel ist ein gleichmässiges Energielevel statt wiederholter Erschöpfungseinbrüche.
-
Ein persönliches Ausgangsniveau finden: Dieses „Baseline“-Niveau dient als Startpunkt, um Aktivitäten schrittweise und kontrolliert auszubauen.
-
Selbstregulation stärken: Ein bewährtes Werkzeug sind die „vier P’s“ – Priorisieren, Planen, Pacing und Problemlösen.
-
Technologie nutzen: Apps zur Aktivitäts- und Symptomüberwachung können wertvolle Unterstützung bieten – auch wenn hier noch weiterer Forschungsbedarf besteht.
Fazit der Studie
Die Ergebnisse zeigen: Wer Fatigue wirksam managen will, muss psychologische, soziale und praktische Barrieren gleichermassen berücksichtigen. Dazu gehören individuell zugeschnittene Bewegungs- und Pacing-Strategien, interdisziplinäre Zusammenarbeit und der Einbau von psychologischer Unterstützung in Behandlungsprogramme.
So entsteht ein Ansatz, der Betroffene nicht nur befähigt, ihre Energie bewusster einzuteilen, sondern ihnen auch hilft, wieder aktiver am Leben teilzunehmen – ohne in den Teufelskreis aus Überlastung und Erschöpfung zu geraten.